
Ein bisher noch nicht da gewesenes Experiment in der reichen emilianischen Provinz: ein offenes Centro Sociale, das das Leben migrantischer Frauen erleichtert. Zwischen politischen Kämpfen, Märkten und Poststationen.
Tische im Freien, gratis Tee und Kaffee, fürs Mittagessen bringt jede etwas mit. Krautsalat und aus der Ukraine importierte Salami sind besonders beliebt: ein ganz normaler Sonntag im Centro Sociale AQ16 in Reggio Emilia. An den Wänden des sozialen Zentrums Graffitis und politische Transparente. Im Garten der Altersdurchschnitt der an den Tischen sitzenden vor allem aus osteuropäischen Staaten und dem Maghreb kommenden Frauen und Männer so um die 50. Diejenigen, die Alkohol trinken, speisen mit einem oder mehreren Gläschen Wodka, es werden russische Lieder angesungen. Heute wird auch ein Geburtstag gefeiert.
Dies ist das "Café Babele", ein vor drei Jahren in Reggio Emilia ins Leben gerufenes Projekt. Was schon an sich etwas Besonderes ist: Weil mit der einfachen Idee, die Türen des Centro Sociale an demjenigen Tag zu öffnen, an dem die migrantischen Arbeiterinnen frei haben, das emilianische besetzte Zentrum zu einem der Referenzpunkte der multiplen Lebenswelten der in der Region lebenden MigrantInnen geworden ist. Es werden kontinuierlich Initiativen wie politische und auch kulturelle Projekte entwickelt. "Hier sind alle eher ein bisschen älter, weil die jungen Frauen vielleicht einen Freund haben, mit dem sie ihren freien Tag verbringen, - erklärt Aleksya - während die reiferen Frauen teils keine Lust auf einen Sonntag in trauter Zweisamkeit, und teils keinen Partner haben. Also kommen sie her, um drei oder vier Stunden hier zu verbringen. Und zum Glück gibt es diesen Ort: Zuerst hatten wir gar nichts und wir mussten im Winter ins Kaffeehaus gehen, um uns zu treffen. Wo es aber nicht möglich ist, vier Stunden lang an einem Tisch zu bleiben."
Aleksya ist Ukrainerin und arbeitet als Pflegehelferin in einem kleinen Ort in der Nähe von Reggio Emilia. Sie ist jung, 35 Jahre. Aber sie verbringt jeden Sonntag Nachmittag hier. Öffnet und schließt das Zentrum, bringt es nach den Nachmittagen in Ordnung und seit kurzem hat sie das Projekt der Bibliothek ins Leben gerufen: Jede bringt ein Buch und kann eines ausborgen. "In Italien ist es schwierig, Romane auf Russisch zu bekommen, also tauschen wir sie gegenseitig".
Selbstorganisierter Markt
Die Lage des Centro Sociale hat ein bisschen zum Entstehen des Projekts beigetragen. Genau außerhalb des Zentrums befindet sich nämlich ein Parkplatz, an dem es seit Jahren einen von MigrantInnen selbst organisierten Markt gibt. Am Parkplatz stehen Duzende weißer Kleinbusse, deren BesitzerInnen hauptsächlich Familien aus dem Osten sind, aus der Ukraine und Moldawien. Es sind auch MarokkanerInnen hier, die Teppiche oder Decken ausstellen. Aus der ehemaligen Sowjetunion hingegen kommt alles Mögliche an: Essiggurken (ogurzy) etwa, die - wie die KäuferInnen behaupten - "nicht dieselben sind wie in den italienischen Supermärkten": sie sind doppelt so groß. Dann gibt es das kornij khleb, Schwarzbrot. Getrockneten oder geräucherten Fisch. Wodka beliebter und gesuchter Marken. Und natürlich russische Bücher und Zeitungen, unter denen auch die begehrte Komsomoloskaja Pravda ist, die schon zu Zeiten der Sowjetunion weitverbreitetste Tageszeitung gewesen war.
Aber der Markt ist vor allem auch ein Ort des Austauschs zwischen EmigrantInnen und deren Heimatländern. Beinahe alle Busse haben Tafeln, auf denen die Zwischenhaltestellen der Reise Richtung Osten eingezeichnet sind. Die Funktion dieser Kleinbusse ist in Wirklichkeit - neben dem Verkauf von Waren - hauptsächlich die eines Postboten. Die MigrantInnen, die in Italien leben, kommen zum Parkplatz voller Pakete, Taschen, und Schachteln. Auf jedes wird eine Zahl geschrieben. Die Zahl steht für eine Familie, die bei der Ankunft das Paket abholen wird. Sie verschicken Geschenke, aber auch Lebensmittel, die die Region "Emilia Romagna" weltberühmt machen: Parmesan, Wein, Salami. Die Kosten für den Versand sind pro Paket in etwa 1,50 Euro pro Kilo. Wenn man Geld verschickt, zahlt man drei Euro pro 100 Euro.
Bei Kleinbussen wie diesen ist es auch geschehen, dass sich jemand heimlich darin einschleicht, um illegal nach Italien zu reisen. Aber heute ist das Problem für viele hingegen, wieder aus Italien herauszukommen. Weil wenn du "illegal" bist, riskierst du immer, dass dich jemand nach einem gültigen Personalausweis fragt. Diese Kontrolle kann zu einer Tragödie werden: Denn der Abschiebungsstempel bedeutet, 10 Jahre in keines der Schengenländer mehr einreisen zu dürfen. Was sollten sie also tun, die Hunderten Hausarbeiterinnen und Pflegehelferinnen, die genau in diesen Tagen die "'chiamata' per i flussi" erwarten?
Dieser besagte Brief, von der Präfektur an den Arbeitgeber und die (in Theorie zukünftigen) Arbeitnehmerinnen verschickt, teilt seinem/r ArbeitnehmerIn mit, dass die jeweilige migrantische Arbeitnehmerin aus einem Nicht-EU Land zu den Glücklichen gehört, die auf die Liste derer kommen, die in diesem Jahr auf legalem Weg nach Italien reisen dürfen. Aber nachdem das Gesetz vorsieht, dass der/die ausländische ArbeitnehmerIn sich auch im Heimatland befindet, muss er/sie auch dort ein Visum für eine legale Einreise nach Italien beantragen. Schade nur, dass die ArbeiterInnen, die an dieser Ausschreibung teilgenommen haben, bereits hier wohnen und (irregulär) arbeiten (und genau dies ist den staatlichen und regionalen Institutionen bestens bekannt, Anm. d. Übers.). Und heute sind viele in Panik, weil sie nicht wissen, wie sie es schaffen sollen, ohne Kontrollen in ihr Heimatland zurückzureisen.
Zwischen einem Tee und einem Kaffee
Das ist heute der Hauptdiskussionspunkt unter der Nachmittagssonne im Café Babele. Zwischen Tee und Kaffee liegen Flugblätter und Broschüren, die die italienischen Gesetze erklären, AktivistInnen des Centro Sociale, die im Rahmen des Projektes Melting pot (www.meltingpot.org, zahlreiche Artikel sind auch auf Englisch abrufbar, Anm. d. Übers.) über die italienischen AusländerInnengesetze, etc. geschult wurden, organisieren einen Informations- und Rechtshilfestand. Aber es geht bei weitem nicht nur um nicht nur um eine Kenntnis der Gesetzeslage. Denn wenn mensch vor Problemen steht, die einem/r auch absurd erscheinen mögen, und nicht versucht, eine Protestaktion zu organisieren, beginnen die Menschen wieder, sich zuhause einzuschließen, die Praxis des kollektiven Handelns und Kämpfens geht verloren. Bei der Frage der "illegalen Wiedereinreise" (ins Heimatland) zum Beispiel, haben sie es genau so gemacht, so Federica Zamboni, eine der Pionierinnen des Cafè Babele: "Wir haben uns eines Nachmittags mit allen Frauen, die vor der selben Situation gestanden sind, hier getroffen und haben uns gefragt, was wir machen können. Im Laufe der Diskussion hat sich ein Vorschlag herauskristallisiert: wir schreiben einen Brief ans Rathaus!, und genau das haben wir auch gemacht." Der Bürgermeister hat sie auch empfangen. Die Frauen haben ihr Problem erklärt, er meinte, dass sie recht hätten und er über die Möglichkeit nachdenken würde, einen Aufruf an die Regierung zu schreiben. Es kam nie eine Antwort, aber dennoch: Für die Frauen des Cafè Babele war klar, dass auf Ungerechtigkeiten kollektiv reagiert werden muss.
Der nächste Kampf könnte besser ausgehen: Hier sind die ProtagonistInnen aber zum Großteil Männer. Auch sie beinahe alle aus Osteuropa. Sie sind die Unsichtbaren: die im Baugewerbe Tätigen. Dies erzählt, an einem der Tische des Café Babele sitzend, Dmitrij aus Moldawien, illegalisiert in Italien und von Beruf Maurer. Er trägt das T-Shirt "No CPT" ("Gegen Abschiebegefängnisse"), das von der Demonstration des 3. März 2007 in Bologna stammt. Jemand hat ihm geraten, es nicht so oft zu tragen: es könne bestimmte Menschen, die es sehen, nervös machen. Aber er, der an der Demonstration teilgenommen hat, hat geantwortet: "Ich ziehe das an, was mir gefällt." Abgesehen davon ist Dmitrij einer der Hauptverantwortlichen einer etwas ungewöhnlichen "rechtlichen Aktion": "Hier passiert folgendes", erzählt er. "Wir sind ja ohne Aufenthaltsgenehmigung, und die Chefs am Bau haben gecheckt, wie es funktionieren kann: sie zahlen uns die ersten zwei, drei Monate. Dann beginnen sie, Probleme zu machen: Sie sagen, dass dieses Mal der Lohn verspätet ist, dass wir ein bisschen warten sollen. Du arbeitest und wartest. Dann verstehst du den Wink irgendwann: Sie zahlen dir gar nicht mehr. Theoretisch können wir sie auch verklagen, aber damit riskieren wir die Abschiebung." Ist das möglich? "Natürlich", sagt Dmitrij. "Es ist gerade einem Freund vor wenigen Tagen passiert: Er ist zur Finanzpolizei gegangen, um den Baustellenleiter, der ihm seit Monaten keinen Lohn gezahlt hat, zu verklagen. Die haben sich bei ihm bedankt und ihn zum Polizeipräsidium zur bald darauf folgenden Abschiebung begleitet." Ein ziemliches Problem. Man hat heute auf den Tischen des Cafè Babele darüber gesprochen. Die übliche Frage: "Was machen wir?" Das Problem sollte, zum Teil durch ein Gesetz, das den Artikel 18 des AusländerInnengesetzes verändern soll, gelöst werden können. Und zwar jenes, das die Aufenthaltsgenehmigung als sozialen Schutz auch auf "ArbeitssklavInnen" ausdehnen wird. Nach dem vielen Reden hat die Regierung beschlossen, einen Gesetzesentwurf zu verabschieden, der schließlich vom Parlament abgestimmt werden muss. Wer weiß, wann dies geschehen wird. In der Zwischenzeit werden die illegalisierten ArbeiterInnen abgeschoben.
Mit Briefen, so viel ist mensch im Café Babele klargeworden, kommt man nicht weit. Deshalb wird diesmal über eine komplexere Aktion nachgedacht. Mit einem Rechtsanwalt gemeinsam einen kollektiven Prozess Duzender Bauarbeiter gegen große Bauunternehmen zu führen (dieser Prozess ist inzwischen schon im Laufen, Anm. d. Übers.) und dies mittels Pressekonferenzen, etc. in den Medien offen zu legen. Und - so hofft man - durch die mediale Resonanz denjenigen Migranten, die als Kläger viel aufs Spiel setzen (von Drohungen durch die teils mafiös organisierten Baufirmen bis zur Abschiebung, Anm. d. Übers.), einen zumindest symbolischen Schutz bieten zu können. Gerade für morgen sind JournalistInnen ins Centro Sociale eingeladen worden, um das neu entstandene "Komitee der irregulären ArbeiterInnen" ("Comitato dei lavoratori irregolari") zu präsentieren.
Ein Licht geht auf
Aber das Café Babele ist nicht nur ein Treffpunkt, an dem über mit dem Fremdenrecht in Zusammenhang stehende Probleme diskutiert wird. Beim Mittagessen spricht man/frau über alles: über das Leben im allgemeinen, über FreundInnenschaften, über die im Herkunftsland zurückgelassene Familie, über Kinder. Und gerade bei diesen "Alltags"konversationen ist für Federica Zambelli - von Beruf Schauspielerin - so etwas wie ein Licht aufgegangen. "Ich hab festgestellt, dass ich... ja, ich kenne das gesamte Fremdenrecht und weiß, was es heißt, in Italien MigrantIn zu sein. Aber ich wusste so gut wie nichts vom Leben, von der kollektiven Vorstellungskraft dieser Frauen, von ihrer Vergangenheit, obwohl ich so viele Kämpfe gemeinsam mit ihnen geführt habe." Zum Beispiel hat sie Tschernobyl entdeckt.
"Ja, man kann sagen, dass ich es entdeckt habe. Natürlich, ich wusste, was damals geschehen ist, ich erinnerte mich gut daran, ich war damals ein junges Mädchen, als es passiert ist: es kam mir so vor, als wüsste ich das Wichtigste. Und hingegen nicht. Hier haben alle eineN mehr oder weniger nahen VerwandteN, der/die in die Tragödie involviert war. Krankheiten, mit denen man auch heute noch zu kämpfen hat, geliebte Personen, die damals gestorben sind." Federica, abgesehen davon, dass sie eine Karte genommen und nachgeschaut hat, wo Tschernobyl eigentlich liegt, weil davon hatte sie in Wirklichkeit keine Ahnung, hat angefangen, die Geschichten der Frauen des Café Babele anzuhören und sich Notizen zu machen, Bücher zu lesen. Es ist daraus ein Theaterstück entstanden, "Grido silenziso" ("Stiller Schrei"), inspiriert durch das Buch "Preghiera per Chernobyl" ("Gebet für Tschernobyl") von Svetlana Aleksievic und, natürlich, von den Geschichten der Frauen des Café Babele.
Das Spektakel wurde in verschiedenen Centri Sociali Italiens aufgeführt. Die erste Aufführung, fand klarerweise im Aq16 in Reggio Emilia statt. Federica verwandelt sich auf der Bühne in eine ukrainische Frau, die an einem italienischen Bahnhof ankommt und schon die notwendigen Kontakte hat, um als Pflegehelferin zu arbeiten. Auf den Zug wartend - und ogurzy essend, erinnert sie sich an jene Nacht in Tschernobyl, in der ihr Ehemann, von Beruf Feuerwehrmann, beim Brand eingeschritten ist. Und dann die Rätsel und Geheimnisse, ihre unendlichen Versuche, ihren aufgeschwollenen Mann, der verschiedene Farben annahm, zu heilen, während sie versteckte, dass sie schwanger war. "Wer wusste es, wie konnten wir es wissen?", ist der Satz, den Federica wiederholt. Wie wahr das war, versteht man vom Schluchzen der Zuhörerinnen: Weinanfälle von Seiten der ukrainischen Frauen, die an der Realisierung des Theaterstücks mitgeholfen hatten. Als die Lichter angehen, gibt es eine Standing Ovation. Und das schönste Kompliment für die Schauspielerin: "Es sieht genauso aus, als wärst auch du dabei gewesen,." Und hingegen: Federica ist lediglich eine ständige Besucherin an den Holztischen des Café Babele.
Dieser Text von Cinzia Gubbini wurde übersetzt von Stephanie Weiss für :: lila - blattform für generationenübergreifenden feministsichen diskurs, nr. 3 sommer 2007
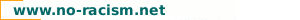

 migration
migration