Giuseppina Nicolini hat dafür gekämpft, dass der Strand von Lampedusa ein Naturreservat wird. In Österreich ist die Bürgermeisterin nicht so sehr für ihren Einsatz für Flora und Fauna bekannt; viel mehr las man über ihren außergewöhnlichen Einsatz für die auf Lampedusa strandenden Flüchtlinge. Augustin-Gespräch mit Bürgermeisterin Giuseppina Nicolini.
«Für die Schildkröten zu kämpfen und die Menschen, die im Meer sterben, zu übersehen - das geht gar nicht.»
Während in Österreich also hysterisch eine Krise konstruiert wird, um die lang versprochene «Notverordnung» durchsetzen zu dürfen, wird auf einer kleinen Insel aus einer realen Herausforderung das Beste für alle gemacht. Mit der Bürgermeisterin von Lampedusa sprach Theresa Bender-Säbelkampf.
Wie ist die aktuelle Situation auf Lampedusa?
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir der Welt beweisen konnten, dass man den Ausnahmezustand bewältigen kann. Die Ankunft der Flüchtlinge auf Lampedusa ist nicht vorhersehbar wie ein Erdbeben. Flüchtlinge kommen seit 20 Jahren und ich habe mir vorgenommen, die Insel aus dem Ausnahmezustand herauszuholen. Wenn die Politik versagt, leben beide Seiten schlecht: die Ankommenden und auch die Lampedusaner. Wenn aber alles organisiert ist und jede Institution ihre Pflicht erfüllt, verbessern sich die Lebensumstände der Flüchtlinge genauso wie die der der lokalen Bevölkerung. Vielleicht ist es unnötig, das zu erzählen - Sie können sich ja selber ein Bild machen.
Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie die verschwindende Aufnahmebereitschaft von Seiten vieler europäischer Länder beobachten?
Das ist auch eine Sache der Geographie. Die ist wichtig, denn sie teilt uns Aufgaben in der Geschichte zu, die andere nicht haben, und sie erfordert einen anderen Blickpunkt: Die Personen, die hier ankommen, sind für uns Schiffsbrüchige, bevor sie überhaupt Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge oder Asylwerber sind. Der Kontinent müsste die neuen Bürger eigentlich aufnehmen. Das ist Menschenrecht. Häufig werden sie aber als Invasoren gesehen. Die Daten sagen uns, dass die Migrant_innen der Wirtschaft mehr geben, als sie bekommen. Den Fremden als eine Gefahrenquelle zu sehen, ist natürlich ein kulturelles Problem - es wird von der politischen Propaganda instrumentalisiert. Das Thema der Einwanderung ist für Populisten wie ein Dietrich, der das Tor zur Machterlangung aufbricht. Wahr ist, dass heute alle Personen mit gesundem Hausverstand wissen, dass Europas eigentliche Krise nicht die Flüchtlingskrise ist, sondern die der Wirtschaft. In meinen Augen könnte Lampedusa ein Modell für den Kontinent darstellen. Es ist wahrscheinlich herausfordernder, den Strom der Fliehenden zu bewältigen, als sich in der Integration eines Teils von ihnen zu engagieren, weil der ankommende, unvorhergesehene Strom unbestimmt ist. Er verlangt große menschliche Ressourcen, große Mittel. Diejenigen, die uns vorwerfen: «Ihr lasst sie herein und dann schickt ihr sie zu uns», vergessen, dass unser Einsatz kontinuierlich ist. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, welche Integration wir verfolgt haben. Wir müssen an unserem Bewusstsein arbeiten, korrekte Informationen liefern und die politische Propaganda bekämpfen.
Laura Boldrini, die viel erlebt hat, gereist ist und vieles gesehen hat, schreibt in Ihrem Buch «Alle zurück», dass man sich nicht an den Schmerz der Menschheit gewöhnen kann, doch andauernd sterben Frauen, Männer und Kinder im Meer. Schätzungen der IOM zufolge sind in diesem Jahr (bis Anfang August, die Red.) bereits 3000 Personen im Mittelmeer gestorben. Befürchten Sie, dass wir uns bereits daran gewöhnt haben?
Das ist ein sehr empfindliches Thema und auch ein schwieriges. Ich frage mich oft, ob es sich auszahlt, ein bestimmtes Foto zu zeigen oder nicht. Ich beobachte die Wirkung. Das Foto des syrischen Buben Ailan, der tot am Strand lag, hat eine große emotionale Antwort hervorgerufen, aber die Emotion muss am Leben gehalten werden. Die Gefahr, die auch ich sehe, ist die Gewöhnung. Wir alle wissen, dass es Hunger in der Welt gibt, wenn wir im Fernsehen oder auf Fotos Kinder sehen, die auf bis das Skelett heruntergehungert sind einen aufgeblähten Bauch haben. Dann beruhigen wir unser Gewissen mit Spenden und glauben, wir hätten unsere Pflicht erfüllt. Diesen Mechanismus gibt es auch angesichts der andauernden Schiffsunglücke, manche nehmen sie erst wahr, seit Papst Franziskus unsere Insel besucht hat. Aber es ist keine Neuheit, es betrifft die Geschichte der letzten 20 Jahre, doch auch zuvor kamen Flüchtlinge auf der «Reise der Hoffnung» an. Es musste darüber gesprochen werden, weil sonst die Stille und die Verschwiegenheit verhindert hätten, dass Brüssel die Pflicht wahrnimmt, sich darum zu kümmern. Sie entscheiden nichts, sie machen nichts, es hat sich nichts verändert und es ändert sich nichts. Wieviel Zeit es noch brauchen wird, damit sich etwas ändert, das weiß ich nicht, aber es darf nicht mehr zu viel Zeit vergehen. Heute kann niemand sagen, dass er oder sie nichts davon wusste. Auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft für mich ist, dass wir eine Gesellschaft und eine Welt geschaffen habe, die auf Zynismus basiert, habe ich noch Hoffnung, dass wir die Dinge ändern können.
Eine bekannte österreichische Wochenzeitung hat kürzlich Ihre Coverseite mit dem folgenden Satz betitelt: Was hat das Sterben im Mittelmeer mit uns zu tun? Gibt es in Ihren Augen eine kollektive Verantwortung oder müssten wir bereits ein kollektives schlechtes Gewissen haben?
Sowohl das eine als auch das andere. Das Schöne daran, auf Lampedusa zu leben, ist, dass wir eines Tages nicht um Verzeihung bitten müssen, weil wir hier sind und wir machen, was in unseren Möglichkeiten besteht. Wenn man vom Mittelmeer spricht, scheint es, als wäre es etwas, das niemandem gehört. Ohne das Mittelmeer und die Überquerungen des Mittelmeers gäbe es keine Bevölkerung in Europa, vielleicht nicht einmal den Reichtum, den wir gewonnen haben im Gegensatz zu einer Welt, die wir geplündert haben. Ich glaube, dass sich zuerst etwas im Norden Europas ändern muss, damit gewahr wird, welch ein Reichtum das Mittelmeer ist.
Im Juni diesen Jahres wurde das «Museum des Vertrauens und des Dialogs» auf Lampedusa eröffnet, mit einer Sektion, wo Objekte der Migrant_innen, die in Lampedusa angekommen sind, ausgestellt werden...
... die der Überlebenden, der Opfer des Schiffsbruchs. Es gibt zwei Theken, wo Gegenstände der Opfer des Schiffsunglücks vom 3. Oktober 2013 ausgestellt sind. Weiter gibt es Zeichnungen von einem syrischen Mädchen. Sie gab sie den Journalisten, um ihnen ihre Geschichte zu erzählen. Es gibt auch Zeichnungen eines Burschen aus Eritrea, der der Folter ausgesetzt war; er erzählt sein Schicksal als Schicksal vieler junger Männer, die aus Eritrea fliehen.
Kann die Erinnerung die Menschheit vor Fehlern bewahren?
Die Erinnerung ist fundamental. So lernen wir als Kinder, Angst zu haben, uns den Kopf anzuschlagen. Schlägst du dir ihn zum ersten Mal an, erfährst du Schmerz. Die Kultur, also das ganze Ensemble von Bekanntschaften, Erfahrungen aus über Jahrtausenden, wird mit der Erinnerung weitergegeben. Das ist fundamental, sonst bringt es nichts, Mensch zu sein, dann wären wir Bestien.
In vielen Erzählungen über menschliches Handeln wendet sich die handelnde Person erst im Laufe seines Lebens dem Humanismus zu. Was denken Sie darüber?
Mir würde es gefallen, dass einer, der weit entfernt lebt, der die großen Schiffe nicht sieht, der nicht versteht, wie die Flüchtlinge unterwegs sind, nicht die Gründe für diese Reisen versteht, die Wahrheit mittels einer unmittelbaren Erzählung erfährt. Daher bin ich glücklich, wenn ihr kommt, um zu sehen, und es weiter verbreiten könnt. Ich sorge gerade dafür, dass von Lampedusa aus positive Nachrichten in die Welt gehen, dazu gehört auch das Museum des Vertrauens. So kann man die Gefahr der Gewöhnung an die Tragödie bekämpfen. Die Schiffsbrüchigen müssen uns Lampedusanern vertrauen. Für sie sind wir die ersten Europäer, die sie sehen. Das Vertrauen, das wir in sie investieren, verlangt im Grunde weit weniger Mut, weniger Anstrengung als jene Energie, die ihnen abverlangt. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, weil sie den Menschen aus Lampedusa vertrauen. Und wenn ihr Schiff schon halb untergegangen ist, glauben sie zutiefst, dass sie es schaffen. Wir müssen diesem Vertrauen gerecht werden. Deswegen haben wir es Museum des Vertrauens genannt. Es wirkt auf mich wie das richtige Wort in diesem Moment, in dem wir im Zeichen des «Kriegs gegen den Terrorismus» zur Abschottung gegenüber den Flüchtlingen gedrängt werden.
Interview von Theresa Bender-Säbelkampf, zuerst erschienen in der Wiener Straßenzeitung :: Augustin #420 vom 13. Sep 2016.
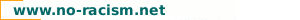


 grenzregime
grenzregime