
Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch eines 18jährigen Asylwerbers auf dem Stadtplatz in Steyr, OÖ, fand am 20. Oktober 2007 ebendort eine Kundgebungen gegen die unmenschliche Abschiebepraxis statt. Ein Bericht von afrikanet.info.
Steyr, 20. Oktober 2007 - Dennis Maklele, der sich aus Verzweiflung über seine drohende Abschiebung ein Messer in den Bauch rammte, ist froh, dass er noch lebt. Inzwischen ist er aus dem Spital entlassen worden. Die Demonstration am Stadtplatz in Steyr bezeugte Mut, Durchhaltekraft und Solidarität im Schneeregen. Gespräche mit in Steyr lebenden AfrikanerInnen.
Es wird trotz allem eine aufmunternde Demonstration, effizient und rasant durchgezogen, denn es ist eiskalt in der Stadt mit den zwei Flüssen. Im Schneeregen spielt die Blasmusik und eine afrikanische Frau mit einem Umhang, der aus der Fahne von Senegal genäht ist, tanzt zu den Klängen. Fröhlich schwenkt Fatou eine kleine österreichische Fahne. Ungefähr dreihundert Leute versammelten sich am Samstag am Stadtplatz in Steyr, um, anlässlich der schweren Selbstverletzung des 18jährigen Asylwerbers Dennis Maklele, gegen die Politik der Deportationen zu protestieren. "Es hätten ihn mehr Leute zur Fremdenpolizei begleiten müssen", betont Makleles ehemalige Flüchtlingsbetreuerin in ihrer Rede. "Er hat sich das so gewünscht. Er war schwer enttäuscht, dass nur wenige kamen. Das Wort 'Gefängnis' hat bei ihm eine große Panik ausgelöst." Dieter Schindlauer, Obmann der Antirassismus-Organisation ZARA, beschreibt die Taktik von Politikern die Angst ihrer BürgerInnen zu schüren und sich dann als die großen Beschützer aufzuspielen: "Wir machen es diesen Fremden nicht angenehm in Österreich, keine Sorge. Ihr braucht keine Angst zu haben, liebe Bürger, dass die dann bei uns bleiben wollen." Es klingt beinahe wie Kabarett, wie der in Steyr aufgewachsene Jurist, alltägliche politische Praxis beschreibt.
"In Österreich herrscht leider eine konservative Politik vor", leitet der Soziologiestudent Paul, wie Fatou ebenfalls aus Dakar, seine Rede ein. Ein roter, dicker Wollfaden wurde vom Stadtplatz bis zur Kirche herauf als Kette der Menschlichkeit gezogen, was später zu einigen Verwicklungen und Stolperern führt. "Man muss es wagen über die Gesetze zu diskutieren, denn es sind sonst allein die Politiker, die über wichtige Dinge entscheiden. Wenn die Gesetze das Zusammenleben zwischen den Menschen von hier und von anderswo nicht mehr fördern, muss man darüber reden. Ich besitze keine österreichische Staatsbürgerschaft und ich wähle nicht, aber ich lebe hier und ich befolge das Gesetz, deswegen bin ich betroffen", erklärt Paul. "Ich mag es nicht, dass die Politiker jeden Tag über Ausländer reden. Es gibt viele andere Themen. Mich macht es unsicher, wie oft es um dieses Thema geht. Wir haben ein Recht auf ein normales Leben, warum redet man immer über uns?", fügt er später im Interview hinzu.
Mein Uropa, der Sklave
Im warmen Kaffeehaus nach der Demo erklärt Fatou ihre Sicht der Lage. "Mein Geschäft ist seit vier Jahren ein Treffpunkt für alle möglichen Leute, Afrikaner, Türken, Österreicher... Ich will, dass sie bei mir ihre Probleme vergessen und ein bisschen lachen. Ich kämpfe dafür, dass ich akzeptiert werde. Die Hälfte der Leute sind gut und nett, aber warum will die andere Hälfte, dass ich zurück gehe? Wir, die Afrikaner hassen nicht. Wir hatten immer ein hartes Leben. Warum hassen die uns? Die weißen Leute sind glücklich und sitzen lachend zusammen. Ich denke nicht, dass dein Uropa meinen Uropa als Sklave gekauft hat. Mein Opa, ein Trommler, der viel gereist ist, sagte mir: Wenn du in ein Land gehst, sei nicht schwierig, mach alles zusammen mit den Leuten, zusammen arbeiten, zusammen lachen. Ich kämpfe weiter und die Leute sollen uns akzeptieren." Fatou sieht die Politik global: "Warum ist Afrika arm? Unsere Uropas arbeiteten in den USA und Europa als Sklaven. Du arbeitest für diese Leute und machst alles. Wenn der Sklavenhandel nicht gewesen wäre, sähe die Lage heute anders aus. Und weil wir arm sind, kommen wir hierher, um zu arbeiten und die schimpfen uns. Manchmal denke ich, dass ich meinem Uropa hierher gefolgt bin und seine Trauer und Wut auslebe." Und wieder folgt ein Zitat von ihrem Großvater. "Mein Opa hat gesagt, du musst leben wie ein Sklave, arm sein, Hunger, Schmerzen und Schwierigkeiten gehabt haben, bevor ein Mensch ein Mensch wird. Wenn du reich geboren bist und reich stirbst, kennst du das Leben nicht." Maklele ist für sie "wieder neu geboren. Er war zwischen Leben und Tod. Er hat jetzt noch so viel zu tun und zu reden. Er hat es für uns alle getan." Fatou schmeißt die Hände in die Luft: "Was gibt uns die Kraft zu bleiben?"
Schweige-Mauer
"Die Jungen sind sehr traurig, dahinter steckt die Verzweiflung", sagt Paul, der im Flüchtlingsheim arbeitet. "Du versuchst, mit ihnen zu reden, aber es gibt eine Mauer von zwanzig Jahren. Du kannst diese Mauer nicht durch brechen. Die Jungen reden überhaupt nicht, die behalten ihre Probleme für sich. Sie sagen nicht alles." Wenn die Jungen aber zu ihm kommen, gibt er ihnen einen Rat. "Ich bin wie ein großer Bruder." Dass viele afrikanische Flüchtlinge in schweren Situationen keine Schwäche zeigen wollen und nach außen hin freundlich bleiben, obwohl sie tief gekränkt oder verletzt sind, erklärt er sich so: "Afrikaner sind nicht anders als andere Menschen. Das ist die soziale Kultur. Man muss stark bleiben. Bei Frauen ist dieses Verhalten oft noch stärker als bei Männern. Wir sind normalerweise immer in der Familie, in der Gruppe, man kontrolliert sich. Wenn man wie Maklele alles verliert, und noch dazu in einem Land lebt, in dem einen die Leute nicht lieben, passiert so eine verzweifelte Tat." Während beim Integrations-Fußballtunier die Bälle fliegen, meint er noch, dass der Selbstmordversuch für ihn eine Überraschung war, die ihn "tief berührt" hat. "Maklele war elf Jahre alt, als er seine Familie verloren hat. Man kann nicht immer stark sein."
Dieser Artikel von Kerstin Kellermann erschien zuerst am 22. Okt 2007 auf :: afrikanet.info mit Bildern Hermann Stadler.
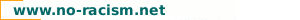


 bleiberecht fuer alle
bleiberecht fuer alle