
Wie werden Ereignisse zu Katastrophen? Und wer zieht daraus einen Nutzen? Ein Versuch der Beantwortung dieser Frage anhand der Berichterstattung vor der und rund um die euro-afrikanische MinisterInnenkonferenz zu Migration und Entwicklung in Rabat.
Endlich waren sie an einen Tisch gekommen. Laut Aussagen diverser PolitikerInnen und zahlreicher Medienberichte sogar zum ersten Mal: Die VertreterInnen von Herkunfts-, Transit- und Zielländern von Migration. Doch alleine ein Blick auf die TeilnehmerInnenliste der Konferenz (:: pdf) zeigt, dass dem nicht so sein kann. Denn da tummeln sich zwar VertreterInnen zahlreicher afrikanischer und europäischer Staaten, doch kommen lange nicht alle MigrantInnen, die in die EU einreisen, aus Afrika. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass es sich um eine bestimmte "Art" von MigrantInnen handeln muss, über deren Kopf hinweg Strategien der Migrationsverhinderung ausgehandelt werden.
In den Monaten zuvor hatten sich bereits die sog. ExpertInnen getroffen, um einen Aktionsplan auszuhandeln, mit dem dem "Drama der illegalen Migration" (so stand es in einigen Medienberichten) begegnet werden sollte. Die Interessen waren zweifelsohne unterschiedliche. Wobei es sich im Folgenden lediglich um die Interessen der MigrationsexpertInnen, der VertreterInnen von 27 afrikanischen und 30 europäischen Staaten, der EU-Kommission und 10 bis 20 internationaler Organisationen, wie der :: IOM, handelt. Denn sie waren es dann auch, deren Aussagen und Positionen die Inhalte der zahlreichen Medienberichte bestimmten.
Als Ausgangspunkt diente ein Katastrophenszenario vom September 2005. Damals versuchten 100e MigrantInnen gemeinsam die Zäune der spanischen Enklaven in Marokko, Ceuta und Melilla, zu überwinden. Es handelte sich dabei weder um den ersten, noch um den letzten Versuch, in die sog. Festung Europa einzudringen. Doch es passte vom Zeitpunkt sehr gut in die Pläne der MigrationsverhinderInnen. Denn nur wenige Tage zuvor trafen sich VertreterInnen der Regierungen von Spanien und Marokko in Córdoba und Sevilla, um weitere Verschärfungen migrationsbehindernder Maßnahmen und den militärischen Ausbau der Grenzüberwachung auszuhandeln. Für Marokko dienten die tödlichen Versuche, die Grenzzäune zu überwinden als Argument, um Geld von Spanien bzw. der EU zu fordern. Alleine sei das Land dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und Spanien nutze die Gelegenheit, um die Überreste der Kolonien in einen Ausnahmezustand zu versetzen und vorübergehend das Militär zu entsenden. Gleichzeitig ging ein Apell an die Europäische Union, nicht tatenlos zuzusehen. Diese reagierte zugleich und beschloss wieder einmal, mehrere Millionen Euro in die Militarisierung von Grenzen investieren.
In den Folgemonaten war nur noch wenig über die Ereignisse an den Zäunen und in den Wäldern rund um Ceuta und Melilla zu hören. Doch :: die Aggressionen gegen MigrantInnen gehen ungehindert weiter. Die Bilder hunderter Menschen, die von marokkanischen Behörden :: in die Wüste deportiert und dort ihrem Schicksal überlassen wurden, gerieten ebenso schnell in Vergessenheit, wie die :: Gewalt durch marokkanische und spanische Polizeikräfte, während die Stürmung der Festung Europa weiterhin ein Dauerbrenner war. Immer wieder konnte dieses (Feind)Bild einer scheinbaren Bedrohung für Europa aufgegriffen werden. Seit damals wird ständig über die tausenden Flüchtlinge aus Afrika berichtet, die versuchen, "illegal" in die EU einzureisen. Doch drehen sich die Erzählungen der Mainstreammedien meist um besonders dramatisierbare Beispiele, die leicht instrumentalisiert werden können.
So wurden die Medien hellhörig, als im März 2006 Berichte veröffentlicht wurden, denen zu folge seit November 2005 mehr als 1.000 Personen beim Versuch :: ums Leben gekommen sind, mit kleinen, ausrangierten Fischerbooten die kanarischen Inseln und somit die EU zu erreichen. Ein Blick in :: die Statistik seit dem Jahr 2000 zeigt, dass dies nichts besonderes ist. Denn seit damals haben offiziellen Angaben zufolge Jahr für Jahr mehr als 10.000 MigrantInnen diesem Weg gewählt. Und seit damals gehören angeschwemmte Leichen zum Alltag auf den Kanarischen Inseln.
Doch nun konnten diese Meldungen aufgrund der sich dramatischen Zuspitzung in Folge des Ausbaus des Zauns um Ceuta und Melilla genutzt werden, um ein neues Bedrohungszenario zu zeichnen. Die :: zahlreichen Toten an der Südgrenze Europas stellten erneut eine :: humanitäre Katastrophe dar.
Die Reaktionen folgten von verschiedenen Seiten. Im Newsletter von :: Migration und Bevölkerung wird berichtet:
"Bereits im April beschlossen Vertreter(Innen) aus 50 afrikanischen Staaten in Algier einen Plan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. In den einzelnen Staaten sieht der Plan vor, gegen Schleuser(Innen) sowie gegen Armut und Jugendarbeitslosigkeit vorzugehen. Es wurde vereinbart, gemeinsame Richtlinien für den Umgang mit Migration zu erarbeiten. Die Europäische Union wurde aufgerufen, legale Einreisen durch die Erleichterung der Visa-Bestimmungen zu fördern. Die EU müsse helfen, 'der Not von Millionen junger Afrikaner(Innen), die vor Elend und Unterentwicklung fliehen, ein Ende zu setzen'.
Damit legten diese Staaten einen Grundpfeiler für die weitere Zusammenarbeit mit der EU im Rahmen der nachbarschaftlichen Migrationsverhinderung. Auf der schon zuvor von Marokko und Spanien ausgerufenen und von Frankreich unterstützten Migrationskonferenz sollten Einigungen erzielt werden. Doch die Interessen prall(t)en aufeinander. In einem Kommentar im St. Galler Tagblatt ist zu lesen:
"Aus europäischer Sicht erscheinen afrikanische Migrant(Inn)en vor allem als Hungerleider(Innen) in untauglichen Booten, die daran gehindert werden sollen, nach Europa zu gelangen. Als ehrgeizige junge Menschen, die bereit wären, Arbeiten zu verrichten, die viele Europäer(Innen) nicht mehr verrichten wollen, sieht man sie nicht. Europa beklagt seine Überalterung und will doch keine jungen Menschen aus Afrika, die Kinder wollen und in Sozialversicherungen einbezahlten, wenn man sie arbeiten liesse.
Dennoch bleibt der Aktionsplan von Rabat ausgerechnet da vage, wo es um den Nutzen für Afrikaner(Innen) in Afrika ginge. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel sollen verbessert, Projekte, die Arbeitsplätze schaffen, geplant werden. Die meisten Afrikaner(Innen) arbeiten in der Landwirtschaft. Doch in Europa werden Bauern (und Bäuerinnen) immer noch so großzügig subventioniert, dass kein(e) afrikanische(r) (Bäuerin) Bauer mithalten kann. Butter aus Europa ist in Marokko billiger als einheimische. Französische Tiefkühlpoulets in Senegal günstiger als eigenes Federvieh. An Westafrikas Küsten hungern Fischer(Innen), während schwimmende Fischfabriken aus Europa ihre dort gemachten Fänge auf den Kanarischen Inseln entladen, die unter dem Ansturm verarmter Afrikaner(Innen) stöhnen."
Europa will sich aussuchen, was gut für Afrika ist. Und vor allem will sich Europa, so das Argument von PolitikerInnen wie Frankreichs Innenminister Nicolas Sarkozy, seine ZuwanderInnen selbst aussuchen können. Und die, die trotzdem heimlich einreisen, sollen möglichst unkompliziert wieder "rückgeführt" werden. Denn "illegale Migration" ist das Feindbild. Und dieses muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden. Kein Wunder also, dass manche PolitikerInnen aus Afrika gelegentlich die europäische Politik kritisieren. Einer davon ist Senegals Außenminister Cheick Tidiane Gadio. In der taz vom 12.7.2006 wird er zitiert: "Die systematische Verweigerung von Visa ist ein Anreiz zur illegalen Migration."
Laut taz waren sich beide Seiten einig, dass nur wirtschaftliche und nicht militärische Lösungen die "illegale Migration" tatsächlich verringern könnten. Deshalb sind im Aktionsplan, der in Rabat beschlossen wurde, neben verstärkten Sicherheitsmaßnahmen auch Entwicklungsprojekte in den Herkunftsländern der Flüchtlinge vorgesehen. So soll vor allem in Transportwege und Kommunikationsmittel investiert und die Wasserversorgung verbessert werden. An sich keine schlechte Idee, wären da nicht zahlreiche Vorgaben, die afrikanische Staaten zu erfüllen haben. Die meist im Rahmen von sog. Strukturanpassungen vor sich gehende Privatisierung der Infrastruktur führt letzten Endes dazu, dass sich viele Leute die grundlegenden Dinge zum Überleben nicht mehr leisten können, in eine Abhängigkeit geraten und sich mehr und mehr verschulden. Viele sehen die einzige Lösung in ihrer Situation im Versuch, in Europa Fuß zu fassen, um sich und der oft zurückgelassenen Familie das Überleben zu sichern. Die Wege sind sehr verschieden und hängen auch vom Geld ab, das den Reisenden zur Verfügung steht. Je mehr bezahlt werden kann, desto sicherer wird die Reise. Und je mehr die Abschottung intensiviert wird, umso teurer, aufwendiger und gefährlicher werden die Versuche, nach Europa zu gelangen.
Dies wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Und da bei der Konferenz in Rabat zahlreiche weitere Maßnahmen zur Abschottung beschlossen wurden, ist davon auszugehen, dass die Gewalt und die Gefahren für die zu FeindInnen erklärten Menschen zunehmen werden. Deshalb klingt es ironisch, wenn als Ausgleich dazu "größere Anstrengungen bei der Entwicklungshilfe" genannt werden. Denn die afrikanischen Staaten mussten dafür zahlreiche Zugeständnisse machen. So strebt die EU eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen FluchhelferInnen und kleinen ReiseunternehmerInnen an, sollen die MigrantInnen in Zukunft schon möglichst an der Ausreise gehindert und die Herkunftsländer zu einer verstärkten Überwachung ihrer Grenzen verpflichtet werden. Auch gemeinsame Patrouillen der Westküste Afrikas bei Marokko, Mauretanien, Senegal und Kap Verde werden von der EU-Grenzschutzagentur "Frontex" mit den betroffenen Ländern durchgeführt. Die Pläne dazu gibt es schon lange, doch trotz mehrmaliger Ankündigungen laufen diese nur zögernd an. Denn das Außenministerium von Senegal wehrte sich Anfang Juni 2006 :: gegen die Praxis der "Rückführungen". Es würde erst dann wieder die Rückführungen akzeptieren, sobald Spanien formell die Würde der Menschen respektiere und die Rückführungen "unter menschenwürdigen Verhältnissen" organisiere. Dass sich die Praxis wesentlich geändert hat, ist nicht anzunehmen, aber angeblich sollen mittlerweile die ersten Leute von den Kanaren nach Senegal gebracht worden sein.
Der Rheinische Merkur schrieb dazu am 15. Jun 2006: "Da man einen Aufstand an Bord befürchtete, mussten die unfreiwilligen Passagiere Handschellen tragen. Der Senegal weigert sich seither, Zwangsrückkehrer(Innen) aufzunehmen, weil bei diesem Flug die Menschenrechte verletzt worden seien. Spanische Diplomat(Inn)en bemühen sich, die Sache einzurenken. Vermutlich werden einige Millionen an Entwicklungshilfe fließen. Auf solche Hilfe setzt die Regierung in Madrid ohnehin. Die Bootsflüchtlinge kommen nicht aus Furcht vor Unterdrückung, sondern aus Not. Im Staatshaushalt sind deshalb die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit verdoppelt worden. Vizeregierungschefin Fernández de la Vega, die vor kurzem auf einer Goodwill-Tour in mehreren afrikanischen Staaten war, hat eine 'diplomatische Offensive' für die Länder südlich der Sahara angekündigt."
Denn es geht darum, die Interessen Europas durchzusetzen. Was macht es da schon, wenn sich der "Schutz der europäischen Grenzen vor illegaler Immigration" (Megawelle Canarias, 07. Jul 2006) um ein paar Wochen verzögert und die "Operation Frontex" erst Ende Juli 2006 startet? Denn der "Grund für die Verzögerung ist ein Einlenken der Regierung Senegals." EU-Grenzschutzkommissar Frattini hat mittlerweile den Beginn der Mission bekannt gegeben. Seiner Meinung nach haben die afrikanischen Herkunftsländer die "Verpflichtung", ihre heimlich nach Europa gekommenen Landsleute wieder aufzunehmen. In der Praxis würden die Rückführungen jedoch oft daran scheitern, dass viele Flüchtlinge ihre Herkunft verschleiern und ihre Nationalität nicht eindeutig festgestellt werden kann. Deshalb hat die EU-Komission in Rabat angekündigt, "zivile Interventionseinheiten" bereitzustellen, die für die Identifizierung und die Schaffung einer "gemeinsamen Datenbasis" zuständig sein wird. Damit ist wohl gemeint, dass den MigrantInnen im Falle eines Aufgriffes nun schon in Afrika Fingerabdrücke abgenommen werden und die Behörden auch auf entsprechende Daten in Europa und umgekehrt zugreifen können.
Und zur Freude der EU haben sich die afrikanischen Staaten bereit erklärt, "Rückübernahmeabkommen" für illegale EinwanderInnen auszuhandeln. Dies wird wohl im Rahmen von bilateralen Verträgen zwischen einzelnen Staaten geschehen. Im Gegenzug soll die legale Einwanderung nach Europa vereinfacht werden. Ein Blick auf die nationalen Gesetzgebungen zeigt jedoch, dass dies nicht so schnell geschehen wird. Denn die EU-Staaten feilen weiterhin an Abschottungsmaßnahmen und Internierungslagern und versuchen vor allem, Menschen zur :: "freiwilligen Rückkehr" zu überreden. In zahlreichen Staaten gibt es derzeit keine Möglichkeit zur legalen Einreise, schon gar nicht in Verbindung mit einem längeren Aufenthalt oder einer Beschäftigung. Lediglich für sog. Schlüsselarbeitskräfte, UniversitätsprofessorInenn oder SpitzensportlerInnen ist dies derzeit im Bereich des Möglichen. Und selbst diesen wird immer wieder die Einreise verwehrt, wie kürzlich den :: Teams aus Ghana und Nigeria zur WM im Streetfootball in Deutschland.
Von den Hunderttausenden, die laut Medienberichten in Afrika auf eine Gelegenheit warten, nach Europa zu gelangen, werden wohl nur wenige der Voraussetzungen erfüllen, die Europa vorschreibt. Für sie bleibt nur die Möglichkeit der heimlichen Migration nach Europa. Denn als KritikerInnen befürchten wir, wie die OÖNachrichten vom 12. Juli 2006 schreiben, "dass sich Europa stärker abschotten wird und die Hilfszusagen nur Lippenbekenntnisse sind."
Trotzdem wollen wir diese der Vollständigkeit halber nennen. Denn im Aktionsplan sind unter den über 60 Empfehlungen neben "legaler" und "illegaler Migration" auch welche zum Thema Entwicklung zu finden. So sollen laut NZZ vom 12. Juli 2006 in den Hauptauswanderungsgebieten "Projekte in arbeitsintensiven Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei, Handwerk und Tourismus gefördert werden. Die Geldüberweisungen der Migrant(Inn)en in ihre Heimat sollen kostengünstiger und als Entwicklungsfaktor nutzbar gemacht werden. Die Ausbildung der Migrant(Inn)en in Europa soll gefördert und deren Rückkehr in die Heimat stimuliert werden. Die legale Migration soll auf freiwilliger bilateraler Basis erleichtert werden. Dies ist unter anderem deswegen schwer, weil die afrikanischen Regierungen einen 'brain drain' unter ihrer jungen Bevölkerung befürchten, wenn europäische Staaten Quotenregelungen einführen, wie sie zum Beispiel in Frankreich zurzeit unter dem Titel der 'immigration choisie' diskutiert werden."
Um zu garantieren, dass die Beschlüsse auch umgesetzt werden, wurde in alter EU-Tradition eine neue Institution ins Leben gerufen. Ein euro-afrikanisches "Migrations-Observatorium" soll die bessere Erfassung und Lösung des Problems ermöglichen, eine Folgekommission die Umsetzung des Aktionsplans betreiben. Sicher ist, dass die Pläne vorangetrieben werden, wenngleich noch nicht klar ist, wie dies vor sich gehen wird. So gab die französische Europaministerin Catherine Colonna laut Kurier bekannt, dass dem Treffen in Rabat bis zum Jahresende eine weitere Konferenz folgen werde, an der auch Algerien, eines der wichtigsten Transitländer das der Konferenz in Rabat fernblieb, teilnehmen soll. Während laut NZZ DipolmatInnen aus Spanien ein Folgetreffen nach spätestens zwei Jahren vorschlugen. Außerdem sei der Zeitrahmen für die Evaluation des Erreichten mit maximal vier Jahren durch eine zweite MinisterInnenkonferenz eher weit gesteckt. Und Deutschland plant bereits eine EU-Afrika Konferenz für die Zeit während des EU-Vorsitzes 2007.
Doch die :: Visionen der AbschottungsstrategInnen Europas werden ein Stück weiter wahr. Denn die ersten :: Internierungslager außerhalb der Schengengrenzen sind :: in Afrika bereits in Betrieb. Siehe dazu auch die von migreurop angefertigte :: Lagerkarte (pdf). Zuletzt wurde auf Initiative und mittels Finanzierung Spaniens ein :: Lager an der Küste Mauretaniens errichtet. Dorthin werden jene transportieren, die bei der Überfahrt auf die Kanarischen Inseln abgefangen werden. Um dann möglichst in die Herkunftsländer "rückgeführt" zu werden. Am Geld für diese Pläne mangelt es ebenso wenig, wie am Willen. Doch darüber wird derzeit nur wenig gesprochen...
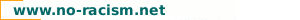


 zur bildergalerie
zur bildergalerie
 grenzregime
grenzregime