
Nur eine Öffnung der Grenzen wird die Flüchtlings- katastrophe beenden. Wie sich eine globale Bewegungs- freiheit demokratisch begründen lässt. Und warum es dafür eine Politik braucht, die sich selbst in Bewegung setzt. Ein Beitrag von Kaspar Surber aus der WOZ.
Just in dem Moment, in dem die Grenzen und ihre tödlichen Folgen endlich in einer breiten Öffentlichkeit Beachtung finden, werden sie gefestigt. Die europäischen Regierungschefs schrecken nach dem Gipfel von vergangener Woche nicht einmal mehr vor Militärschlägen gegen Schlepper zurück (vgl. :: «Schiffe versenken vor der libyschen Küste»). Doch Grenzen sind mehr als Verkettungen von politischen Machtdemonstrationen und juristischen Ausschlusskriterien, von Polizeipatrouillen und Nachtsichtgeräten - und von Lücken, die der Teufel lässt. Eine Grenze beginnt in der Sprache.
Ein Beispiel dafür ist die letzte Ausgabe der Wochenzeitung «Die Zeit». Die Schlagzeile auf der Titelseite lautete: «Wir wollen nicht, dass sie kommen. Wir wollen nicht, dass sie ertrinken. Was wollen wir tun?» Da wurde - selbst in aufrichtiger Betroffenheit - die Grenze wieder einmal messerscharf gezogen: «Wir» hier drinnen, «sie» da draussen. «Wir», die wünschen und bestimmen, und «sie», die begehren und sterben. Und wie immer, wenn eine Grenze nach aussen gezogen wird, schlägt sie auch nach innen zurück: Offenbar haben «wir» in Europa alle die gleiche ohnmächtige Haltung. Als ob nicht - von Italien bis Deutschland, von Spanien bis Polen und auch in der Schweiz - BürgerInnen seit Jahren unentwegt für eine andere Politik kämpften allem Spott («Gutmenschentum!») zum Trotz.
«The West and the rest», der Westen und die Übrigen: Diese Unterscheidung hat der Literaturtheoretiker Edward Said in seinem grundlegenden Werk «Orientalismus» 1978 als Prinzip der kolonialen Herrschaft beschrieben. Sie ist in den Diskussionen um die Migrationspolitik noch immer wirkmächtig. Wer die Grenzen öffnen will, weil nur dies das Sterben beenden wird, muss diese Differenz angreifen.
Ein Gedankenexperiment
«Wir müssen die Einwanderung selbst steuern können»: So lautet ein oft gehörter Grundsatz von rechten PolitikerInnen, zuletzt gegen die Personenfreizügigkeit in Europa. Die Ergebnisse der Migrationsforschung stellen allerdings infrage, ob es überhaupt eine Steuerung der Migration geben kann. Die Migration folgt selten den oft beschworenen Push- und Pull-Faktoren, aus der die Rechte und auch Teile der etablierten Linken ihre Politik der Härte ableiten. In einer Art negativem Standortmarketing soll die Schweiz als Fluchtziel aus dem Süden möglichst «unattraktiv» erscheinen.
Doch die Migration hat viele Motive: politische Verfolgung, wirtschaftliche Möglichkeiten und nicht zuletzt den Eigensinn der MigrantInnen. Wenn nachfolgend nicht treffgenau zwischen Flucht und Migration unterschieden wird, dann nicht, um den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention abzuschwächen, der Schutz vor politischer Verfolgung garantiert. Die Möglichkeiten der legalen Migration sind vielmehr zu erweitern.
Bedenklicher an der Steuerungsfantasie der Rechten ist ihre Anmassung, über Menschen zu bestimmen, die selbst nicht mitbestimmen können. Demokratie kann man wie folgt definieren: Jede Person, die dem Zwang staatlicher Gesetze unterworfen ist, muss den Anspruch haben, über den Inhalt dieser Gesetze mitbestimmen zu können. In diesem Sinn ist die Migrationspolitik ein demokratischer Skandal: In den Schweizer Gefängnissen waren 2013 - so die aktuellsten Zahlen des Bundesamts für Statistik - mehr als ein Siebtel der Insassen Asylsuchende. Häufig haben sie nichts anderes verbrochen, als dass sie nicht über die richtigen Papiere verfügen oder deswegen Bagatelldelikte verübten. Zu niederträchtigen Disziplinierungsformen, wie sie beispielsweise die Ausschaffungshaft darstellt, wurden sie nie um ihre Meinung gefragt.
«Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen!» Der trotzig-freche Demospruch, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint, passt auf die Schweizer Justiz im Jahr 2015. Die Festung Europa manifestiert sich auch innerorts.
Will man die Migrationspolitik hingegen demokratisch begründen, so ist es lohnenswert, das bekannte Gedankenexperiment des Philosophen John Rawls durchzuspielen. Er fragte, für welche Gerechtigkeitsgrundsätze sich freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse entscheiden würden, wenn sie ihre soziale Stellung vorher nicht kennen würden. Rawls kam zum Schluss, dass sie sich dieselben Grundfreiheiten zusichern würden und dass Ungleichheiten nur dann gerechtfertigt wären, wenn sie noch dem am schlechtesten gestellten Mitglied einer Gesellschaft zum Vorteil reichten. Übertragen auf die Migrationspolitik, die alle potenziell Betroffenen berücksichtigt, heisst das: Demokratisch und gerecht ist sie erst, wenn sie allen die gleiche Bewegungsfreiheit zusichert.
Wer unter den touristisch erfahrenen SchweizerInnen würde sich schon dagegen entscheiden, mit einem Schweizer Pass geboren zu werden, der fast überall auf der Welt die Türen öffnet? Nirgendwo wirkt die Migrationspolitik so bigott wie an der Bye-Bye-Bar am Flughafen Kloten. Und so veraltet.
Über Jahrhunderte erprobt
In der Schweiz funktioniert die Bewegungsfreiheit zwischen den Kantonen seit dem vorletzten Jahrhundert, und zwar inklusive sofortiger Beteiligung am Stimmrecht bei der Niederlassung. In Europa funktioniert sie seit wenigen Jahrzehnten zwischen den Staaten, gebunden an den Nachweis einer Arbeitsstelle oder eines Studienplatzes. Warum soll die Bewegungsfreiheit nicht auch weltweit funktionieren? Oder zumindest unter den Staaten, die mitmachen wollen?
Gerade die Osterweiterung der Europäischen Union hat gezeigt: Wohl findet mit der Personenfreizügigkeit eine Migration in wirtschaftlich prosperierende Regionen wie etwa die Schweiz statt - zumindest solange es hier offene Arbeitsstellen gibt. Die von den rechten Parteien an die Wand gemalte «Armutsmigration» aus Osteuropa aber ist ausgeblieben. Der Lohndruck für alle lässt sich bewältigen, wenn es Mindestlöhne und einen Kündigungsschutz für langjährig Beschäftigte gibt.
Die Vorstellung, dass bei einer Öffnung der Grenze Richtung Süden «halb Afrika» nach Europa kommen würde, folgt einzig dem kolonialen Stereotyp, wonach es die BewohnerInnen des afrikanischen Kontinents nur als anonyme Masse gibt. Demgegenüber war die Feststellung des Migrationsforschers François Gemenne im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» offenbar so überraschend, dass sich die Zeitung im dazugehörigen Kommentar gleich wieder davon distanzieren musste: dass bei einer Öffnung der Grenzen nicht mehr Menschen als heute kämen, aber alle überleben würden. Im Übrigen finden gemäss Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowieso achtzig Prozent der Flüchtlinge weltweit in den Nachbarländern Aufnahme, häufig in sogenannten Entwicklungsländern. Nur ein Bruchteil gelangt nach Europa.
Realistischerweise wird ein Modell der globalen Personenfreizügigkeit derzeit fast überall an den politischen Mehrheiten scheitern. Doch sie kann immerhin den Horizont für eine fortschrittliche Politik bilden. Alle Forderungen, die in diese Richtung zielen, sind zu begrüssen: die Aufnahme von Flüchtlingskontingenten und die Wiedereinführung des Botschaftsasyls, die Rückkehr von der Not- zur Sozialhilfe und die Aufhebung des Arbeitsverbots für Asylsuchende. Und entsprechende Forderungen mehr.
Zum Schluss bleibt die Frage, welche Form eine solche Politik haben könnte. Wenn jede gute Politik ihr Ziel bereits formal vorwegnehmen soll, dann muss die Organisation in sich die Unterscheidung zwischen dem Westen und dem Rest überwinden. Sie muss das Kommando der Migration - «Vorwärts!» - übernehmen und selbst zu einer Bewegung werden. In den regionalen Solidaritätsnetzen ist das schon häufig der Fall. Hier kämpfen SchweizerInnen und Asylsuchende für eine gemeinsame Perspektive. Die Gewerkschaften verstehen sich seit der Abschaffung des Saisonnierstatuts ebenfalls als Stimme von Beschäftigten mit und ohne Schweizer Pass.
Die Hasenfüssigkeit der SP
Dringend ist, dass sich von den etablierten Parteien neben den Grünen auch die SP wieder als Teil dieser Bewegung sieht. Dass sie sich im laufenden Wahlkampf nicht einmal mehr traut, für die Personenfreizügigkeit der Schweiz mit den EU-Staaten einzustehen, ist an Hasenfüssigkeit nicht zu überbieten. Dass sie bei der Höhe von Flüchtlingskontingenten - ein einfacher Vorschlag, der zahlreiche Menschenleben retten kann - vom BDP-Präsidenten links überholt wird, passt dazu. Er fordert die Aufnahme von 50 000 zusätzlichen Flüchtlingen. Die Zeit drängt, dass die SP ihren Kurs ändert. Nicht weil in ein paar Monaten Wahlen sind. Sondern weil die nächsten Flüchtlingsboote bereits wieder ablegen.
In einer Bewegung, die nicht ständig nach der Herkunft fragt, sondern die eine Gesellschaft in der Zukunft sucht, in einer Bewegung, die international agiert, könnten unhinterfragte Begriffe, letztlich ganze Koordinatensysteme, plötzlich ins Wanken geraten: Was zum Beispiel heisst «Hilfe vor Ort»? Das könnte ja auch einmal bedeuten, dass eine Kommission von eritreischen Deserteuren Schweizer Ausschaffungszellen auf ihre Menschenrechtstauglichkeit hin untersucht.
Dieser Artikel von Kaspar Surber erschien zuerst in der schweizerischen :: WOZ - Die Wochenzeitung Nr. 18/2015 vom 30.04.2015.
Kaspar Surber hat im Echtzeit-Verlag das Buch «An Europas Grenze. Fluchten, Fallen, Frontex» veröffentlicht. Es berichtet von den Schauplätzen der europäischen Migrationspolitik. Bereits 2012 erschienen, hat sich an den Befunden wenig geändert. Das Buch endet mit einem Ausblick
des Philosophen Andreas Cassee, in dem er das im Beitrag erwähnte Gedankenexperiment von John Rawls näher ausführt.
Das Buch ist erhältlich unter anderem in :: WOZ Shop.
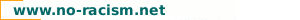


 antirassismus
antirassismus